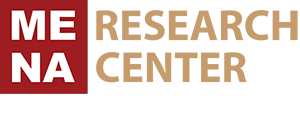Von Golineh Djananpour, Brüssel
Es läuft die letzte Phase im Prozess zur „Affäre der libyschen Finanzierung der Präsidentschaftskampagne von Nicolas Sarkozy 2007“, so heißt die Akte mit vollem Namen. Am 10. April soll der Prozess enden. Wenn stimmt, was die Staatsanwälte für Finanzdelikte vermuten, nachdem sie mehr als zehn Jahre lang ermittelt haben, dann ist das der größte politische Skandal, den dieses Land in den vergangenen Jahrzehnten erlebt hat. Eigentlich hat es so etwas noch nie gegeben.
Die These der Anklage, zusammengefasst in drei Sätzen, lautet so: Nicolas Sarkozy soll für seinen Aufstieg an die Macht Millionen von Muammar al-Gaddafi erhalten haben, dem libyschen Herrscher, einem Paria des Westens, einem Schurken. Im Gegenzug soll Gaddafi von Sarkozy erwartet haben, dass ihn der wieder auf die internationale Bühne schubst, ihm Geschäfte zuschanzt, sogar ein Atomkraftwerk, und dass er seinen verurteilten Schwager aus den Wirren mit der Justiz befreit. 2011, im Arabischen Frühling, soll Sarkozy dann den Sturz Gaddafis befördert haben, und zwar mit seinem persönlichen Engagement für einen internationalen militärischen Einsatz, mit Jets und gezielten Bomben. Sollte der Libyer mit allen seinen Geheimnissen untergehen?
Die Anklage wirft Sarkozy und elf weiteren Personen vor, sie hätten eine Verbrecherbande gebildet, die von einem „Pakt der Korruption“ getrieben wurde. Das Dutzend sind vor allem Franzosen und Libyer. Sollte in ein paar Wochen auch das Gericht zu diesem Schluss kommen, und es braucht dafür keinen absoluten Beweis, es reicht bei Korruptionsfällen schon eine feste Indizienkette, dann drohen Sarkozy eine Haftstrafe von zehn Jahren und eine Geldstrafe von 375.000 Euro.
Sarkozy trägt aktuell eine elektronische Fußfessel am linken Knöchel, nachdem er vor ein paar Wochen in einem anderen Prozess verurteilt worden ist, wegen Richterbestechung. Das mache ihn nur noch stärker, sagte er vor Kurzem, bis zuletzt werde er kämpfen.
Ohne die Reporter von Mediapart, dem unabhängigen französischen Enthüllungsportal hätte dieser Prozess wahrscheinlich nie stattgefunden. Die wichtigsten Dokumente in dieser Affäre, die zentralen Geldflüsse: Fast alles kommt von ihnen. Sarkozy wollte nie mit Mediapart reden, in all den Jahren nicht, seit 2012, als die Publikation mit ihren Recherchen begann. Doch er hat sie mit Anzeigen eingedeckt. Er nennt sie „Gauner“, die nichts anderes im Sinn hätten, als ihn durch den Dreck zu ziehen, zur Not auch mit gefälschten Dokumenten. So sieht er sich, als Opfer. Mediapart gewann bis jetzt alle Prozesse, die er gegen das Portal angestrengt hat. Und der Justiz wirft Sarkozy vor, sie scanne sein Leben, sie reise um die halbe Welt dafür und mache Mittel frei, die sie sonst immer vorgebe, nicht zu haben: „Für mich reicht es immer aus, für mich schon“, sagt Sarkozy.
Sarkozy steht schon an der Anklagebank, neben ihm seine früheren Mitarbeiter und Vertrauten, die mit ihm angeklagt sind. Brice Hortefeux kennt er, seit er einundzwanzig und der achtzehn war. Er nennt ihn „einen Freund, wie ein Bruder“. Er wird ihn in diesem Prozess fallen lassen. Auch Claude Guéant, er ist jetzt achtzig Jahre alt, man sieht sie ihm an. Guéant, früher ein hoher Staatsdiener, Präfekt und Innenminister, war Sarkozys wichtigster Mitarbeiter: Er leitete seine Wahlkampagne, später war er sein Generalsekretär im Élysée. Die sprichwörtliche graue Eminenz.
Sarkozy war zunächst ein sehr populärer Innenminister, bevor er nach dem höchsten Amt im Staat strebte. Er hatte die Rolle neu erfunden, es war immer dieselbe, wirksame Nummer. Wenn etwas passiert war im Land, ein Mord, ein Aufstand in der Banlieue, fuhr er sofort hin, alle Fernsehsender im Schlepptau, und sagte hartes Zeug in die Kameras. Er surfte auf der Welle der Emotionen, er war ein Meister darin. Einmal sagte er, die Banlieue müsse man „mit dem Kärcher“ putzen, „das Gesindel“ mit einem Hochdruckreiniger wegspülen. Der konservative Politiker redete wie die extreme Rechte, ein Populist vor dem Herrn.
„Sarko“ war so populär, dass er als aussichtsreichster Kandidat für die Nachfolge von Jacques Chirac galt, dem Präsidenten von 1995 bis 2007. Guéant, sein Kabinettschef, und Hortefeux, Minister für die Regionen, waren seine wichtigsten Weggefährten. Beide reisten also nach Tripolis und trafen sich mit Abdallah Senoussi, Guéant im Oktober, Hortefeux im Dezember, ohne dass die französische Botschaft davon erfuhr. Niemand sollte etwas wissen.
Senoussi war Gaddafis Schwager, Chef der Geheimdienste, Nummer zwei des Regimes. Und, vor allem\: das Hirn hinter den libyschen Attentaten, die das Land im Westen zum Paria machten. Auch den Abschuss der DC-10 der französischen Fluggesellschaft UTA über der Wüste Ténéré in Niger soll er organisiert haben: 19. September 1989, 170 Tote, unter ihnen 54 Franzosen. Frankreichs Justiz verurteilte Senoussi in Abwesenheit zu einer lebenslangen Haftstrafe, er konnte Libyen nicht mehr verlassen – gefangen daheim. Für den Clan der Gaddafis war diese Verurteilung eine Obsession, sie sollte weg.
Die Pariser Staatsanwaltschaft ist sich nun sicher, dass Guéant und Hortefeux sich mit Senoussi getroffen hätten, um diesen Aspekt des „Korruptionspakts“ zu besprechen. Eingefädelt haben soll die geheimen Treffen ein schillernder Geschäftsmann, wie es sie im Zwielicht schmieriger Deals in Frankreich immer schon gab: Ziad Takieddine, ein Frankolibanese, bestens eingeführt in allen Machtzirkeln. Takieddine wurde einige Monate später mit Koffern voller Cash erwischt, einmal in Genf, einmal am Pariser Flughafen Le Bourget. Beide Male war er auf der Rückreise aus Libyen.
Guéant und Hortefeux müssen dem Gericht und den vielen Angehörigen der Opfer der abgeschossenen DC-10, die auch im Saal 2.01 sitzen, nun erklären, warum sie sich damals mit Senoussi trafen, einem verurteilten Terroristen, inkognito, nicht einmal die Leibwache war informiert. Nur Takieddine war dabei, als Übersetzer. Beide Mitbeschuldigten erzählen exakt dieselbe Geschichte, wie nach Skript, sie hätten nichts gewusst von dem Termin, sie seien in einen „Hinterhalt“ gelockt worden, in eine „Falle“. Und weil ihnen das danach so peinlich gewesen sei, hätten sie Sarkozy nach ihrer Rückkehr nach Paris nichts von dem Treffen mit Senoussi erzählt. Guéant war im Oktober 2005 in Libyen, Hortefeux im Dezember. Dazwischen reiste Sarkozy selbst nach Tripolis.
Sarkozy findet mittlerweile, Guéant und Hortefeux hätten einen Fehler begangen, es habe sich nicht gehört, mit diesem Takieddine zu „kungeln“, wie er es nennt. Aber mit ihm, beteuert Sarkozy, habe das nichts zu tun. Er habe Takieddine nie gemocht, unsympathisch sei der, und unheimlich. „Ich bin doch kein Verbrecher“, sagt er einmal ganz laut. Soll es so wirken, als wären Guéant und Hortefeux auf eigene Initiative nach Libyen gefahren, als hätten sie hinter seinem Rücken ein krummes Ding gedreht? Dabei waren sie doch für ihn da.
Ebenso muss Claude Guéant dem Gericht erklären, wie er in den Jahren nach seiner Reise nach Libyen zu 500.000 Euro kam, übermittelt von einem malaysischen Konto. Es ist die „Geschichte der flämischen Gemälde“, so nennt sie die französische Presse. Und so erzählt Guéant, er habe mal zwei kleine Bilder von Andries van Eertvelt erworben, einem belgischen Maler aus dem 17. Jahrhundert: Seestücke, Marinemalerei, Schiffe im Sturm. Kaufpreis: etwa 50.000 Euro.
Im Herbst 2007, da war Sarkozy schon Präsident, sei er zu einem Anlass in ein Pariser Luxushotel eingeladen worden, von der malaysischen Botschafterin. Dort habe er einen malaysischen Anwalt kennengelernt, der diese zwei Bilder unbedingt kaufen wollte, ohne sie je gesehen zu haben. Für eine halbe Million Euro, also zehnmal über Wert.
Die malaysische Botschafterin sagte den Ermittlern, sie habe Guéant nie kennengelernt, in jenem Herbst sei sie schon seit einem Jahr nicht mehr auf dem Posten in Paris gewesen. Vom malaysischen Anwalt fehlt jede Spur. Guéants Haushälterin erzählte, sie habe diese Gemälde nie gesehen. Und so nimmt die Staatsanwaltschaft an, dass es sich um Geld aus Libyen handelt, das über ein saudisches Konto nach Malaysia und von dort nach Paris floss. Es diente dem Kauf einer Wohnung im 16. Arrondissement, an der Rue Weber. Den Kaufvertrag mit der Anzahlung, 500.000 Euro, hatte Guéant schon unterzeichnet, da war das Geld noch gar nicht eingetroffen.
Der libysche Diktator war schon seit dreißig Jahren nicht mehr in Paris gewesen, er war da unerwünscht, ein Fürst des Terrors. Nun aber wurde er mit Pomp empfangen, seine Gefolgschaft umfasste mehr als hundert Leute. Gaddafi durfte sein Beduinenzelt in den Garten des Hôtel de Marigny stellen, vis-à-vis vom Palais de l’Élysée. Und weil es ihm so gut gefiel, blieb er gleich noch ein paar Tage länger, sprengte das Protokoll. Die Franzosen waren irritiert. Sarkozy empfing eine Delegation, um die Gemüter zu besänftigen. Und Gaddafi war nun endgültig zurück auf der internationalen Bühne, rehabilitiert von Sarkozy. Ein Teil des Deals?
Im Frühjahr 2011, als der Arabische Frühling auch Libyen erreichte, vollzog Sarkozy plötzlich eine Kehrtwende, eine abrupte Abkehr von Gaddafi. Er war der erste Anführer des Westens, der das Ende von Gaddafis Herrschaft forderte. Da meldete sich Saif al-Islam Gaddafi, einer der Söhne des Herrschers, und erzählte im Fernsehen, Libyen habe Sarkozys Wahlkampagne finanziert, er solle den Libyern ihr Geld zurückgeben. Sehr ernst nahm man ihn nicht: Wehrte sich hier nicht die Herrscherfamilie gegen ihren Sturz? Und zwar gegen den Mann, der diesen Sturz mit aller Macht herbeiführen wollte. Das war auch immer die Verteidigungslinie Sarkozys.
Doch dann tauchte das Tagebuch von Schukri Ghanem auf, dem früheren Regierungschef und Ölminister Libyens. Und das entkräftete die These der angeblichen Rache der Libyer.
In einem Eintrag aus dem Jahr 2007, also lang vor dem Arabischen Frühling, schrieb Ghanem in seinem Tagebuch von einem Gespräch mit Baschir Saleh, Gaddafis Mann für die Finanzen, dem Chef eines libyschen Staatsfonds. „Am Mittag habe ich mit Baghdadi und Bechir Saleh gegessen, auf dem Anwesen von Bechir“, schrieb Ghanem. „Bechir sagte, er habe Sarkozy 1,5 Millionen Euro geschickt, und al-Islam habe Sarkozy drei Millionen Euro gegeben. Aber man habe ihnen ausgerichtet, das Geld sei nicht angekommen. Es macht den Anschein, dass ‚Typen‘ es abgezweigt haben, auch zwei Millionen von Abdallah Senoussi sollen sie sich genommen haben.“
Gefunden hatte das Tagebuch die niederländische Polizei, als sie bei einer Razzia zu libyschen Schmiergeldzahlungen die Wohnung von Ghanems Schwiegersohn durchsuchte. Schukri Ghanem war unter mysteriösen Umständen gestorben, im April 2012: Seine Leiche trieb auf der Donau durch Wien.
Das Pariser Gericht interessiert sich auch für die Personalie von Baschir Saleh, dem „Schatzmeister“ Gaddafis, Mitangeklagter im Prozess. Der war den Franzosen so wichtig, dass sie ihn nach dem Sturz des Herrschers im Herbst 2011 aus Libyen exfiltrierten, wie man das im Militärjargon nennt, und nach Frankreich brachten. Offenbar mit einem Helikopter, dann mit einem Marineboot, es geht gar das Gerücht um von einer Reise in einem französischen U-Boot.
So lebte Saleh eine Weile unbehelligt in Paris, man sah ihn durch die Stadt flanieren. Bis Interpol einen Haftbefehl gegen ihn ausstellte. Für Sarkozy war das kein guter Moment: Er bemühte sich gerade um seine Wiederwahl. Die erste Wahlrunde war durch, das Gerede über die Millionen aus Libyen drückte auf seine Chancen.
Der Prozess setzt Sarkozy zu, je länger er dauert. Einmal räumt er ein: „Ich weiß schon, dass es gravierende Indizien gibt, aber sie passen nicht zusammen.“ Früher sagte er immer, die Akte sei leer. Jetzt gibt es darin also „gravierende Indizien“. Formen sie eine feste Kette? Kann das alles sein?