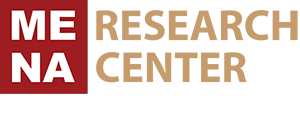Der Übergangspräsident Syriens, Ahmad al-Scharaa, treibt den politischen Übergang in seinem Land mit Nachdruck voran – doch seine Vorgehensweise sorgt für wachsende Skepsis im Westen, unter liberalen Syrern und in den Reihen ethnischer und religiöser Minderheiten. Seitdem der ehemalige Dschihadistenführer an der Spitze einer Allianz islamistischer Milizen die Macht im Land übernommen hat, mehren sich die Zweifel an der künftigen politischen Ausrichtung Syriens.
Besonders drängend sind die Fragen, ob sich das Land unter seiner Führung zu einem konservativ-islamischen System entwickeln wird, in dem Freiheitsrechte und demokratische Prinzipien eingeschränkt werden. Kritiker befürchten, dass grundlegende Menschenrechte, insbesondere die Gleichstellung von Frauen und religiösen Minderheiten, in Gefahr geraten könnten. Auch die politische und gesellschaftliche Stellung der Christen, Kurden und Alawiten gibt Anlass zur Sorge: Werden sie in einem neuen Syrien Bürger zweiter Klasse sein?
Die Alawiten, die religiöse Gruppe, aus der der geflohene Präsident Baschar al-Assad stammt, stehen vor einer ungewissen Zukunft. Seit Jahrzehnten hielten sie die wichtigsten Machtpositionen in Regierung und Militär inne, was sie nun zur Zielscheibe möglicher Vergeltungsmaßnahmen macht. Auch wenn Scharaa mehrfach betont hat, dass in einem Syrien nach der Herrschaft der Assads alle Bürger gleich behandelt würden, bleiben viele dieser Ängste bestehen.
Ein Grund für die anhaltende Unsicherheit ist Scharaas ausweichende Haltung zu zentralen Fragen der künftigen Staatsordnung. Insbesondere beim Thema Säkularismus vermied er bislang eine klare Positionierung. Während liberale Kräfte und Minderheiten einen säkularen Staat als Voraussetzung für ein stabiles und inklusives Syrien sehen, bevorzugen islamistische Gruppen in seiner Allianz eine stärkere Orientierung an der Scharia. Scharaas Unklarheit in diesen entscheidenden Punkten verstärkt die Befürchtung, dass seine Regierung letztlich den Einfluss radikaler Kräfte zementieren und Syrien in ein autoritäres, islamistisches System führen könnte.
Trotz internationaler Appelle, eine transparente und integrative Politik zu verfolgen, bleibt Scharaas Strategie vage. Die internationale Gemeinschaft beobachtet den politischen Transformationsprozess mit wachsender Besorgnis – und auch innerhalb Syriens mehren sich Stimmen, die ein klares Bekenntnis zur Wahrung von Menschenrechten, Pluralismus und demokratischen Strukturen fordern. Wie sich die neue Ordnung tatsächlich entwickeln wird, bleibt ungewiss – doch die bisherigen Signale lassen viele skeptisch zurück.
Mit der Verfassungserklärung, die Scharaa nun unterzeichnete, verhält es sich ähnlich. Sie gibt die Richtung vor, wie Syrien in den nächsten fünf Jahren, der Zeit des Übergangs bis zur Verabschiedung einer dauerhaften Verfassung und Wahlen, regiert werden soll. Scharaa selbst hat erklärt, es werde mit dem Dokument ein neues Kapitel in der syrischen Geschichte aufgeschlagen. Doch auch die Verfassungserklärung hat die Zweifel der Skeptiker nicht ausgeräumt. Auch die Verfassungserklärung lässt Raum für Interpretationen.
Einerseits heißt es darin, Meinungs- und Pressefreiheit und die Rechte von Frauen sollten garantiert, die „persönlichen Angelegenheiten“ der Angehörigen religiöser Minderheiten geschützt werden. Der Staat garantiert demnach die freie Religionsausübung – allerdings mit der Einschränkung, dass es sich um abrahamitische Religionen handeln muss, was zumindest in der Theorie einige Minderheiten, wie zum Beispiel die Yeziden, ausschließt. Außerdem heißt es, „die öffentliche Ordnung“ dürfe nicht gestört werden. Das lässt ebenso eine Hintertür für Bevormundung und Einschränkungen offen wie ein Artikel, in dem es heißt, die „Würde der Frauen“ und ihre Rolle in der Familie und Gesellschaft sollten geschützt werden. Die Rolle des Islams wird außerdem um eine Nuance gestärkt. Wie in der vorigen Verfassung muss der Präsident Muslim sein. Aber anders als zuvor wird die Islamische Rechtsprechung in dem Verfassungsentwurf als „die Hauptquelle der Rechtsprechung“ festgeschrieben, nicht mehr nur unbestimmter als „eine Hauptquelle“.
Westliche Diplomaten und liberale Syrer weisen außerdem auf die außerordentlich starke Rolle hin, die der Präsident für die Übergangszeit zugeschrieben bekommt. Von „einer Art Präsidialmonarchie“ ist sogar die Rede. Zwar wird Gewaltenteilung festgeschrieben. Die Volksversammlung, die als Legislative fungieren soll, wird aber nicht gewählt. Sie soll zu einem Drittel vom Präsidenten ernannt werden. Der Rest der Mitglieder soll von einer Kommission bestimmt werden, die von einem Komitee überwacht wird, dessen Mitglieder wiederum ebenfalls das Staatsoberhaupt ernennen soll.
Auch wenn die Justiz unabhängig sein soll, wird laut der Verfassungserklärung der Präsident die Richter ernennen. „Scharaa könnte auf diese Weise Vertraute in der gesamten Führung unterbringen, ein Netz von persönlichen Abhängigkeiten knüpfen“, sagt ein Diplomat. Schon jetzt befürchten syrische Kritiker, der Machthaber errichte einen tiefen Staat aus Seilschaften, die seine Herrschaft dauerhaft absichern. Misstrauen weckt ferner das festgeschriebene Recht, den Ausnahmezustand zu verhängen. Das Prozedere ist mit Regeln verbunden, er ist auf drei Monate beschränkt und kann nur einmal mit Zustimmung der Volksversammlung verlängert werden. Andererseits ist die jüngere Geschichte der arabischen Welt reich an Präzedenzfällen, in denen der Ausnahmezustand zum Erhalt autoritärer Herrschaft zur Regel geworden ist.
In Syrien regt sich daher Unmut unter den Scharaa-Skeptikern. Offene Kritik kam von den Kurden im Nordosten Syriens. „Wir lehnen jeden Versuch strikt ab, eine Diktatur unter dem Deckmantel einer Übergangsphase wiederherzustellen“, hieß es in einer Stellungnahme des „Demokratischen Rates Syriens“, des politischen Arms der kurdisch dominierten Militärtruppe „Syrian Democratic Forces“, die im Nordosten des Landes das Sagen hat. Der Entwurf werde kategorisch zurückgewiesen und müsse neu geschrieben werden, hieß es weiter. Der Unmut der Kurden, die nach größtmöglicher Eigenständigkeit streben, dürfte sich schon daran entzünden, dass der Name des neuen Syriens „Syrische Arabische Republik“ lautet – noch stärker aber daran, dass Arabisch einzige Amtssprache sein soll. Der Verfassungsentwurf bilde die Diversität Syriens nicht ab, lautet die kurdische Kritik. Es wird erwartet, dass der syrische Übergangspräsident den Forderungen nach mehr Inklusivität zumindest formal gerecht wird, wenn er eine neue Regierungsmannschaft präsentiert. Derzeit regiert ein kleines Team von Vertrauten. Scharaa kann jede Unterstützung dringend brauchen, um die wirtschaftliche Not der Bevölkerung zu lindern, die auch seine Autorität untergraben könnte. Zuletzt waren allerdings mit den Nachrichten über die Ermordung Hunderter alawitischer Zivilisten durch Milizen unter dem Banner der Führung in Damaskus Signale aus Syrien gekommen, die westliche Skepsis verstärkt hatten.