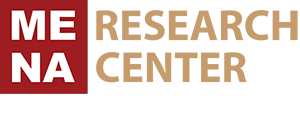Vor einigen Tagen veröffentlichte die türkische Tageszeitung Sabah, die traditionell eine enge Bindung an Präsident Erdoğan pflegt, einen Artikel, der als ein gewisses Angebot an Europa interpretiert werden kann. Der Hintergrund dieses Artikels war die Teilnahme des türkischen Außenministers Hakan Fidan an den Ukraine-Gesprächen in London, bei denen wichtige Akteure aus verschiedenen Ländern zusammenkamen, um über den Krieg in der Ukraine und mögliche diplomatische Lösungen zu beraten. Fidan reiste aus Ankara an, um die türkische Position und ihre Perspektive auf die Entwicklungen in der Ukraine zu vertreten.
Während seines Aufenthalts in London betonte Fidan in seinen Aussagen, dass die Türkei eine Schlüsselrolle nicht nur in Bezug auf die Ukraine, sondern auch auf die geopolitische Stabilität in Europa und darüber hinaus spiele. Er erklärte, dass die Türkei aktiv daran interessiert sei, eine zentrale Rolle in einer „neuen europäischen Sicherheitsarchitektur“ zu übernehmen, die auf die sich wandelnde sicherheitspolitische Landschaft reagiert. Dabei stellte er klar, dass dies nicht nur ein kurzfristiges Ziel sei, sondern Teil einer langfristigen strategischen Vision, die von Präsident Erdoğan verfolgt werde. „Wie Sie wissen“, so Fidan, „hat unser Präsident dazu eine große Vision“, was darauf hindeutet, dass Ankara auf eine bedeutende Neuordnung der Sicherheitsarchitektur in Europa und dem weiteren Umfeld hinarbeitet.
Interessanterweise wies Sabah in ihrem Bericht auch auf einen markanten Gegensatz hin, der die diplomatische Bühne der letzten Tage prägte. Sie hob den „starken Kontrast“ zwischen zwei wichtigen politischen Treffen hervor: dem Gespräch des ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskij mit dem damaligen US-Präsidenten Donald Trump in Washington und Selenskijs späterem Besuch in Ankara. Die Zeitung scheint damit auf die unterschiedliche Ausrichtung der diplomatischen Beziehungen und den jeweiligen Einfluss der beteiligten Akteure auf die Ukraine-Krise hinzuweisen. Dies könnte als subtile Anspielung auf die geopolitischen Spannungen und die Konkurrenz der westlichen und östlichen Mächte in der Region verstanden werden.
Durch diese Darstellung im Sabah wird deutlich, dass die Türkei nicht nur als ein neutraler Akteur im Ukraine-Konflikt gesehen werden möchte, sondern aktiv versucht, sich als entscheidende Stimme in der europäischen Sicherheitsdebatte zu positionieren. Dabei wird auch die enge Verbindung zwischen der türkischen Außenpolitik und den langfristigen Visionen von Präsident Erdoğan betont, die weit über die aktuelle Krise hinausreichen.
Erdoğan war es gelungen, mit beiden Seiten in Kontakt zu bleiben. Neben Viktor Orbán ist er unter den Staats- und Regierungschefs der NATO der Einzige, der Putin seit Kriegsbeginn immer wieder getroffen hat. Er nennt ihn einen „guten Freund“. Aus türkischer Sicht macht ihn das, gerade nach der Pressekonferenz im Weißen Haus, zum idealen Vermittler zwischen der Ukraine und Russland.
Tatsächlich kommt der Türkei in diesen Tagen eine neue Bedeutung zu. Einerseits diplomatisch, dank der Verbindungen in alle Richtungen. Gern wären sie in Ankara schon Gastgeber für die ersten amerikanisch-russischen Gespräche über die Ukraine gewesen, die in Saudi-Arabien stattfanden. Immerhin gelang es Erdoğan, den Besuch Selenskijs in Ankara auf denselben Tag zu legen – während die Außenminister aus Moskau und Washington in Riad sprachen, empfing Erdoğan den ukrainischen Präsidenten, es hatte etwas von einer Gegenveranstaltung. Nun bietet sich die Türkei für Gespräche mit Beteiligung des überfallenen Landes an. „Unsere Region hat genug vom Blutvergießen“, sagte Erdoğan. Er sei zu jeder Hilfe bereit.
Zur Diplomatie kommt das Militärische. Nach der Armee der Vereinigten Staaten ist die türkische die zweitgrößte in der Nato, also die größte unter den europäischen Mitgliedsstaaten. Außerdem lässt Erdoğan seit Jahren eine eigene Rüstungsindustrie aufbauen, die auch der Ukraine zugutekommt. Für den dortigen Krieg bestimmte Munition zum Beispiel kauft das US-Verteidigungsministerium bei einem türkischen Hersteller. Die Türkei hat Kapazitäten aufgebaut, auf die der Westen in diesen Zeiten angewiesen ist.
Erdoğan macht gerade den Eindruck, als suche er die Nähe zu den Europäern. Ein Trump-Putin-Deal, der Russland stärkt, muss auch der Türkei Sorgen bereiten. Erstens hat das Land immer von der Nato profitiert, zweitens gefährdet ein expansives Russland trotz aller netten Worte die türkischen Interessen, im Nahen Osten, in Nordafrika, im Kaukasus. So platzierte Erdoğan also ein Thema mitten hinein in die europäisch-amerikanischen Spannungen, das lange aus den Schlagzeilen geraten war: eine türkische EU-Mitgliedschaft. „Nur die Türkei“, sagte er, „kann die Europäische Union aus der Sackgasse retten, in die sie geraten ist.“
Er entwarf das Bild eines maroden, alternden Staatenbundes, in dem die Islamophobie umgehe und der immer weiter nach rechts abgleite. Seine Sorge wegen des Rechtsrucks in Europa hatte Erdoğan schon angesprochen, als der Bundespräsident kürzlich in Ankara war. Die Türkei, sagte er jetzt, könne „das Lebenselixier“ sein, das die Europäer nötig hätten.
Dass es mit der EU-Mitgliedschaft bald etwas wird, ist unrealistisch. Was Erdoğan aber wohl im Kopf hat, ist eine Art von gehobener Partnerschaft. Einerseits das wirtschaftlich starke, aber geopolitisch-militärisch schwach wirkende Europa; andererseits die Türkei, die noch immer nicht aus ihrer ewigen Wirtschaftskrise findet, die dem Kontinent aber militärisch helfen könnte. Die türkische Armee ist laut „Global Firepower Index“ die neuntstärkste der Welt, die Bundeswehr folgt auf Platz 14. Hinzu kommt der Einfluss der Türkei in Nahost, vor allem im neuen Syrien, und eben auch in der Ukraine.
Eine konkrete Idee hat Erdoğan auch schon, indem er türkische Friedenstruppen in der Ukraine vorschlug. Er habe die Idee sowohl Selenskij bei dessen Besuch vorgetragen als auch dem russischen Außenminister Sergej Lawrow, der nur ein paar Tage später nach Ankara kam. Russland lehnt jede Präsenz von NATO-Truppen in der Ukraine ab, auf Erdoğans Vorstoß hat Moskau aber bisher nicht reagiert.
Die türkische Position ist klar: Man sieht sich in diesen krisenhaften Zeiten als Gewinn für die EU – wenn denn auch die Europäer auf die Türkei zugehen würden, vor allem wirtschaftlich. Kritik am türkischen Krieg gegen die kurdischen Gebiete in Nordsyrien zum Beispiel vermied Brüssel bislang.
In der Türkei zeichnet sich derzeit ein neuer Friedensprozess mit den Kurden ab, der durch die jüngste Botschaft von Abdullah Öcalan, dem inhaftierten Führer der PKK (Arbeiterpartei Kurdistans), angestoßen wurde. Diese Entwicklung könnte es den Europäern leichter machen, sich wieder auf eine Annäherung an die türkische Regierung unter Präsident Erdoğan einzulassen. Die europäische Politik hat traditionell eine ambivalente Haltung gegenüber der Türkei eingenommen, insbesondere aufgrund der Menschenrechtslage und des Umgangs mit der kurdischen Frage. Sollte sich der Friedensprozess weiterentwickeln, könnte dies die politische Dynamik verändern und den Weg für eine intensivere Zusammenarbeit zwischen der Türkei und den europäischen Staaten ebnen.
Dennoch dürfte es noch eine erhebliche Zeit dauern, bis die Beziehungen zwischen Türken und Kurden wirklich stabil sind und von gegenseitigem Vertrauen geprägt werden. Der Friedensprozess steht nach wie vor auf der Kippe, und es bleibt abzuwarten, wie tiefgreifend die Vereinbarungen sein werden, die er umfasst. Die tief verwurzelten Misstrauensbarrieren zwischen beiden Seiten – die auf jahrzehntelangen Konflikten und Gewalt beruhen – sind nicht so schnell überwunden. Der Dialog zwischen der türkischen Regierung und den Kurden ist fragil, und es könnte noch Jahre dauern, bis es zu einem wirklichen, dauerhaften Frieden kommt.
Ein wesentlicher Faktor, der den Verlauf dieses Friedensprozesses beeinflussen wird, ist die Haltung von Präsident Erdoğan. Der türkische Staatschef scheint derzeit nicht bereit, wesentliche Zugeständnisse zu machen, die für eine nachhaltige politische Lösung notwendig wären. Besonders ein heikles Thema ist die Frage nach einer möglichen Amnestie für kurdische Gefangene. Erdoğan hat immer wieder betont, dass er einem solchen Schritt keine Priorität einräumt und bislang keine Bereitschaft gezeigt, die Forderungen nach einer Amnestie für PKK-Mitglieder zu unterstützen. Dies steht im Widerspruch zu den Erwartungen, die von der kurdischen Seite und vielen internationalen Beobachtern gehegt werden, die glauben, dass solche Maßnahmen einen wichtigen Beitrag zum Friedensprozess leisten könnten.
Für Erdoğan ist Öcalans Aufruf zur Niederlegung der Waffen ein symbolischer Akt, der für ihn eine Kapitulation der PKK darstellt. Er sieht sich selbst als denjenigen, der den Sieg im jahrzehntelangen Konflikt errungen hat, was seine Haltung gegenüber weiteren Zugeständnissen beeinflusst. Diese Sichtweise stellt für viele Beobachter eine der größten Herausforderungen dar, denn sie deutet darauf hin, dass Erdoğan die Kurdenfrage vor allem als eine militärische Auseinandersetzung betrachtet, bei der der Staat letztlich gewonnen hat. Dieser triumphalistische Ansatz könnte den Dialog mit den Kurden erschweren und eine echte Aussöhnung verhindern.
Insgesamt zeigt sich, dass der Friedensprozess mit den Kurden in der Türkei noch am Anfang steht und von Unsicherheiten geprägt ist. Der Weg zu einem echten, dauerhaften Frieden, der auf gegenseitigem Respekt und Vertrauen basiert, wird vermutlich lang und von vielen politischen und gesellschaftlichen Hindernissen begleitet sein. Das internationale Umfeld, insbesondere die Haltung Europas, wird dabei eine wichtige Rolle spielen, doch die türkische Innenpolitik unter Erdoğan bleibt der entscheidende Faktor.