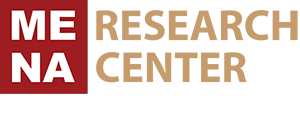Von Arild Svensson, Stockholm
Als der Iraker Salwan Momika im August 2023 in Schweden einen Koran verbrannte, löste er in der islamischen Welt einen Sturm der Entrüstung aus. Westliche Medien berichteten ausführlich, Schweden geriet unter Druck, solche Aktionen gesetzlich zu verbieten, Feuilletonisten warnten vor den Folgen. Doch als Momika letzten Monat während eines Tiktok-Livestreams in seiner Wohnung in der Stadt Södertälje erschossen wurde, blieb sein Tod eine Fussnote in den Nachrichten.
Diese Diskrepanz wirft eine beunruhigende Frage auf: Warum erregt die Verbrennung eines Buches mehr Aufmerksamkeit als der Tod eines Menschen? In der arabischen Welt wurde die Ermordung Momikas teilweise mit Jubel oder Schadenfreude aufgenommen. Die wenigen, die die Tat verurteilten, stellten Täter und Opfer auf eine Stufe. Momika habe sich durch seine Provokationen selbst schuldig gemacht, hieß es. Er habe die Gefühle der Muslime verletzt und sei deshalb genauso radikal wie sein Mörder.
Noch nie war es für Islamkritiker in Europa so gefährlich wie heute. Vielleicht, weil die progressive Identitätspolitik es zugelassen hat, dass religiöse Gefühle mehr zählen als Meinungsfreiheit. Vielleicht, weil einige hundert Seiten Papier – oder das, was sie symbolisieren – für die Diversity-Apostel mehr wert sind als ein Menschenleben.
Salwan Momika wollte beweisen, dass der Koran zum Terror aufruft. Tragischerweise gelang ihm das nur durch seinen eigenen Tod. Doch auch sein Mörder handelte mit heiligem Furor – und steht nicht stellvertretend für alle Muslime. In den Kommentarspalten unter den Nachrichten über Momikas Ermordung finden sich Schadenfreude und Beschwichtigung. Viele Muslime feierten die Tat als Sieg des Islams und als Niederlage seiner Feinde. „Möge sein Tod eine Warnung für all jene sein, die glauben, ihr Leben im ungläubigen Westen sei ausserhalb der Reichweite von Allahs Gesetzen“, schreibt einer. Andere warnen vor den Folgen. „Dieser Mord schadet den Muslimen weltweit“, heisst es in einem Kommentar. „Rechtsextreme werden die Tat ausnutzen, um Gesetze gegen Muslime zu verabschieden.“ Der Autor schliesst mit den Worten: „Der Mörder ist genauso extrem wie der Mann, der den Koran verbrannt hat. Beide sind Feinde der Muslime.
Doch selbst dieser Kommentar offenbart zwei Probleme: Erstens jubeln einige Muslime nach jedem Anschlag eines radikalen Muslims, während andere den Islam und die Muslime als die eigentlichen Opfer darstellen. Für sie ist ein Terroranschlag nicht deshalb schlecht, weil er unmenschlich ist, sondern weil er dem Ansehen des Islams schadet. Zweitens werden Täter und Opfer, Kritik und Gewalt gleichgesetzt. Dabei hat Momika nie zur Gewalt gegen Muslime aufgerufen. Er hatte radikale Ideen, aber er hat sie im Rahmen des Rechtsstaates geäussert.
Die Frage ist, wie wir in Zukunft mit solchen Taten umgehen. Soll jede Koranverbrennung – und jede Kritik am Koran – verboten werden, um Terroristen nicht zu provozieren? Würden sich Terroristen damit zufriedengeben oder auch moderate Kritiker und Islam-Reformer ins Visier nehmen? Wie viel Macht darf der Koran noch haben?