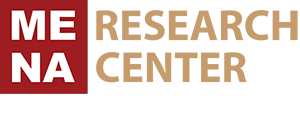Die Frage, ob weibliche Muslime beim Fahren eines Autos voll verschleiert sein dürfen, beschäftigt derzeit bemerkenswert viele Gerichte in Deutschland. Im vergangenen Juli urteilte das Oberverwaltungsgericht Nordrhein-Westfalen in der Sache, im August das Oberverwaltungsgericht Rheinland-Pfalz und im Januar das Verwaltungsgericht in Berlin. Vor wenigen Tagen wurde die Frage am Verwaltungsgericht in Trier geklärt; Urteile an anderen Gerichten stehen noch aus. „Ich habe das Recht, mein Gesicht zu zeigen, wem ich möchte“, sagte eine 46-jährige Klägerin. Die Vollverschleierung durch einen Nikab „ist für mich deshalb ein Gefühl der Freiheit und der Ruhe“.
Die Zahl strenggläubiger muslimischer Frauen, die einen Nikab tragen, wird bundesweit auf eine niedrige dreistellige Zahl geschätzt. Dass dennoch vergleichsweise viele Verfahren anhängig sind, hat auch mit Dennis Rathkamp zu tun. Der 36-jährige gelernte Kfz-Mechatroniker stand nicht nur in Münster der Klägerin zur Seite, sondern auch in Berlin. Rathkamp ist Präsident der Föderalen Islamischen Union (FIU), einem streng konservativen islamischen Verein.
Die Föderale Islamische Union (FIU) aus Hannover ist ein eingetragener Verein mit derzeit – nach Selbstauskunft – 3.579 Mitgliedern, der sich selbst als Advokat für die Rechte aller Muslime in Deutschland sieht. Als selbsternannte Vertretung „aller deutschsprachigen Muslime“ bietet der Verein zum einen religiöse Serviceleistungen für Muslime an (bspw. ein Fatwa-Telefon), zum anderen greift der Verein verschiedene, antimuslimische Vorfälle auf und transportiert diese mittels Social Media gezielt an eine breite Öffentlichkeit. Der Verein bietet u.a. Hilfestellung und Unterstützung bei rechtlichen Auseinandersetzungen (bspw. im Kontext von Hidschab-Verboten) an, und setzt sich laut seiner Website für eine rechtliche Anerkennung bzw. Gleichstellung des Islams als offizielle Religionsgemeinschaft ein. Dass der Islam selbst als Religion rechtlich nicht als Körperschaft des öffentlichen Rechtes anerkannt werden kann, sondern lediglich einzelne Gemeinden, verschweigt die FIU. Dabei ist die Organisation insbesondere darum bemüht, durch öffentlichkeitswirksame Aktionen Anschlussfähigkeit an ein möglichst breites Spektrum deutschsprachiger Muslime herzustellen.
In einer Pressemitteilung von Mitte Januar erklärt die FIU, dass sie nun 20 Nikab-tragende Frauen in ihren Prozessen vor deutschen Gerichten unterstütze. Denn das 2017 erlassene Verbot in der Straßenverkehrsordnung, voll verschleiert Auto zu fahren, folge einer klar erkennbaren politischen Agenda. „Es ist korrekt, dass wir die betroffenen Frauen in diesen Fällen unterstützen“, bestätigt Rathkamp schriftlich auf Nachfrage der Süddeutschen Zeitung. „Wir haben uns als Organisation zum Ziel gesetzt, gegen religiöse Diskriminierung vorzugehen – unabhängig davon, ob diese durch Privatpersonen erfolgt oder politisch motiviert durch staatliche Stellen.“
Auf dem Internetportal der FIU kann man einen Vordruck für einen Antrag auf Ausnahme von der StVO herunterladen. Dazu gibt es auch eine Anleitung, wie er auszufüllen ist. „Dabei ist insbesondere vorzutragen, welcher Religion Sie seit wann angehören und warum das Bedeckungsgebot für Sie religiös verbindlich ist“, heißt es dort. Nach einigen Niederlagen vor Gericht hat der Verein dem Formular eine Art Disclaimer vorangestellt: „Derzeit dürfte der Antrag unter Hinweis auf die negativen Entscheidungen einiger Verwaltungsgerichte meist abgelehnt werden.“
Die deutschen Sicherheitsbehörden rechnen den Verein dem Salafismus zu. Salafisten sind Muslime, die sich an den religiösen Praktiken aus der Zeit des Propheten Mohammed orientieren. Viele tun das nur in Bezug auf ihre eigene private Religionsausübung. Andere haben missionarischen Eifer, manche sind gar gewaltbereit. Niedersachsen lässt die FIU seit Jahren beobachten.
Das mag angesichts einer Handvoll Prozesse um den Nikab übertrieben klingen. Doch sogenannte legalistische Islamisten, zu denen der Verfassungsschutz auch die FIU zählt, würden „rechtsstaatliche Möglichkeiten nutzen, um langfristig Einfluss auf gesellschaftliche und politische Strukturen zu nehmen“, um diese dann auf Grundlage der Scharia, also der islamischen Rechtsprechung, „als allgemeingültiger Ordnung umzugestalten“.
Die Prozesse um das Fahren mit dem Nikab wären demnach nur ein Baustein. So unterstützte die FIU eine Studentin der Universität Kiel, die 2019 gegen das Schleierverbot in den dortigen Hörsälen vorgehen wollte. Ein Jahr später, nach dem Attentat von Hanau, bei dem neun Menschen mit Migrationshintergrund ermordet wurden, startete der Verein eine Online-Petition für einen Bundesbeauftragten zum Schutz der Muslime in Deutschland. Ebenfalls 2020 klagte die Union erfolgreich vor dem Bundesverfassungsgericht gegen die strikten Corona-Verbote bei Gottesdiensten in Niedersachsen. Der Spruch aus Karlsruhe war ein großer Erfolg für den kleinen Verein, der Ende 2017 seine Arbeit mit sieben Mitgliedern begonnen hatte.
Zu den Gründern gehören Dennis Rathkamp und Marcel Krass, sie fungieren heute als Präsident und Sprecher des FIU. Rathkamp und Krass sind vor Jahren zum Islam konvertiert und seit Langem in der Szene der Salafisten bekannt. Zwar bestreiten sie, dass etwa Marcel Krass oder der FIU „in irgendeiner Verbindung zu extremistischen Netzwerken oder Ideologien“ stünden. Deutsche Verfassungsschützer bezeichnen Krass jedoch als „salafistischen Prediger“; die Nähe des Vereins zum Salafismus machen die Verfassungsschützer neben anderem an dem sogenannten Fatwa-Support fest, einer Beratung zu religiöser Rechtsprechung. Außerdem habe die FIU noch bis 2023 angegeben, sich nach dem Verständnis der „frommen Altvorderen“ zu richten, einer fundamentalistischen Auslegung des Islam.
Bei strenggläubigen Muslimen scheint dieses Angebot der Islamischen Union zu verfangen. Aus den sieben Mitgliedern 2017 sind nach Angaben der FIU inzwischen knapp 5.500 geworden; 7.000 Mitglieder seien das Ziel für dieses Jahr. „Die Entwicklung geht so stark nach vorne“, erklärt Rathkamp in einem Selbstdarstellungsvideo, dass das große Ziel des Vereins nicht in 30, sondern bereits in fünf bis zehn Jahren zu erreichen sei: die Anerkennung als Körperschaft des öffentlichen Rechts.
Diese auch „Ehrentitel“ genannte Einstufung ist bislang den großen christlichen Kirchen, einigen jüdischen Synagogengemeinden oder der Heilsarmee vorbehalten und verleiht zusätzliche Rechte. Anders als ein Verein dürfte eine solche Körperschaft als anerkannte Religionsgemeinschaft zum Beispiel Steuern erheben. Zugleich sind die Hürden für diesen Titel hoch. Dazu gehört, dass eine Religionsgemeinschaft nicht nur rechtstreu, sondern durch ihre Struktur und die Zahl der Mitglieder auf Dauer angelegt sein muss. Den Zeugen Jehovas etwa wurde der Titel 2006 erst nach fast 30 Jahren Rechtsstreit zuerkannt.
Dass die FIU ihr Ziel dennoch ernst nimmt, ist schon an der Wahl ihrer Rechtsvertreter zu erkennen: Im Berliner Nikab-Prozess wurde die Klägerin von Benjamin Kirschbaum beraten. Vor drei Jahren hatte Kirschbaum einen ziemlich einmaligen Erfolg zu verkünden: Beraten von ihm und seinem Arbeitgeber, der Kanzlei Winheller, wurde einer islamischen Religionsgemeinschaft in Nordrhein-Westfalen der Status einer Körperschaft zuerkannt.
In der Sache Vollverschleierung am Steuer waren Kirschbaum und auch die anderen Verfahren des FIU hingegen weniger erfolgreich. Weder in Berlin noch in Trier oder andernorts wurde dem Ansinnen der Klägerinnen stattgegeben. Doch nach Einschätzung eines der beteiligten Richter geht es der FIU auch gar nicht um einen Sieg vor einem Verwaltungsgericht. Vielmehr sollten die Fälle bis zum Bundesverfassungsgericht durchgefochten werden.