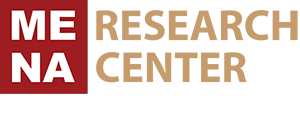Syrien war schon immer ein Land mit vielfältigen Ethnien und Religionen, dessen Gemeinschaften im Laufe der Geschichte erhebliche Veränderungen in Bezug auf Bevölkerungsverteilung und -struktur erfahren haben. Eine der folgenreichsten dieser Veränderungen ereignete sich während des jüngsten Krieges, der auf den Ausbruch der syrischen Revolution im Jahr 2010 folgte. In dieser Zeit zielte das syrische Regime gemeinsam mit seinen Verbündeten auf Gebiete mit sunnitischer Bevölkerungsmehrheit ab – Regionen, die nach der Unterdrückung der großen Stadtplätze durch die Sicherheitskräfte zu Zentren von Protesten und Waffenverbreitung geworden waren. Diese Plätze waren zu Beginn der Revolution Sammelpunkte für Syrer aller Konfessionen und ethnischer Gruppen.
Infolge dieser Entwicklung wurden große sunnitische Gemeinden auf dem Land und in den Städten gewaltsam aus Syrien vertrieben. Dies führte zu einem deutlichen Rückgang der Zahl der sunnitischen Muslime, die eigentlich die Mehrheit der syrischen Bevölkerung stellen. Beobachter argumentieren, dass dieser Prozess bewusst herbeigeführt wurde, um eine grundlegende demografische Veränderung zu bewirken – weitgehend unter der Schirmherrschaft des Iran. Der Iran unterstützte aktiv die Verbreitung des Schiitentums in Syrien und erleichterte die Ansiedlung iranischer und afghanischer Schiiten im Land, von denen einige die syrische Staatsbürgerschaft erhielten.
Bis heute gibt es keine offizielle oder verlässliche Volkszählung über die Gesamtzahl der Syrer oder ihre konfessionelle und ethnische Verteilung. Schätzungen der Weltbank aus dem Jahr 2023 gehen von etwa 23 Millionen Einwohnern aus. Das Jusoor Center for Studies meldete im Jahr 2023 eine Gesamtzahl von rund 26 Millionen Syrern, davon etwa 16 Millionen innerhalb Syriens und rund 9 Millionen außerhalb des Landes, zusätzlich zu 897.000 Getöteten oder Vermissten.
Neben der sunnitischen Bevölkerung beherbergt Syrien auch andere islamische Gruppen, darunter Alawiten, Ismailiten und andere schiitische Konfessionen. Laut Schätzungen des US-Außenministeriums machen diese Gruppen zusammen etwa 13 % der Bevölkerung aus.
Die syrische Vielfalt geht über konfessionelle Linien hinaus und umfasst mehrere ethnische Gruppen wie Kurden, Armenier, Turkmenen, Tscherkessen und andere. Araber bilden die überwältigende Mehrheit, gefolgt von den Kurden. Es gibt keine offiziellen Zahlen zur kurdischen Bevölkerung in Syrien, aber die meisten Schätzungen gehen von 2 bis 3 Millionen aus. Sie leben hauptsächlich in der Region Hasaka, in der Stadt Qamischli, in Ayn al-Arab (Kobani), Afrin sowie in Stadtteilen von Damaskus und Aleppo, wie das Jusoor Center berichtet.
Der Bericht des US-Außenministeriums zur Religionsfreiheit von 2022 gab an, dass 74 % der Bevölkerung sich als Sunniten identifizieren, mit ethnischer Vielfalt unter ihnen – hauptsächlich arabische Sunniten, aber auch Kurden, Tscherkessen, Tschetschenen und einige Turkmenen.
Ein Bericht der französischen Forschungsplattform Orient XXI aus dem Jahr 2020 stellte fest, dass der Krieg Syriens demografische Zusammensetzung erheblich verändert hat. Arabische Sunniten, die früher die Mehrheit bildeten, stellen nun nur noch etwa die Hälfte der Bevölkerung.
Die syrische Gesellschaft tendiert zur Mäßigung
Die vorherrschende sunnitische Rechtsschule in Syrien ist die hanafitische Schule, deren Anhänger mehr als 60 % der sunnitischen Bevölkerung ausmachen. An zweiter Stelle steht die schafiitische Schule. Historisch gesehen war die schafiitische Schule in Syrien dominant, bevor der osmanische Staat aufstieg. Sie blieb bis ins 18. Jahrhundert vorherrschend, trotz der Bemühungen der osmanischen Zentralmacht, der hanafitischen Rechtsschule besondere Privilegien einzuräumen.
Die hanafitische Schule gilt als eine der gemäßigteren Rechtsschulen im Islam. Sie ist bekannt für die Anwendung von Analogieschluss (Qiyās) und juristischer Präferenz (Istihsān) zur Ableitung von Rechtsurteilen. Diese Herangehensweise zeigt die Flexibilität der Schule und ihre Fähigkeit, auf moderne Probleme und sich verändernde Realitäten einzugehen.
Der sunnitische Teil der syrischen Gesellschaft ist bekannt für seine Mäßigung. In der Levante gibt es auch Anhänger der malikitischen Schule. Das Ministerium für religiöse Stiftungen (Awqaf) hatte früher vier offizielle Muftis, die jeweils eine der vier sunnitischen Rechtsschulen vertraten, zusätzlich zum Großmufti der Republik. In den Moscheen wurden Unterrichtseinheiten zu allen vier Rechtsschulen angeboten, wobei jeder Imam gemäß seiner eigenen Schule lehrte.
Auch der Sufismus ist in Syrien weit verbreitet und wird in unterschiedlichen Graden von Mäßigung praktiziert, was sich in der Vielfalt der Sufi-Orden widerspiegelt. Einer der bekanntesten Orden ist die Qadiriyya, benannt nach dem Sufi-Scheich Abdul Qadir al-Dschilani. Von diesem Orden gingen mehrere Zweige aus.
Ein weiterer bedeutender Orden ist die Naqschbandiyya, zurückgeführt auf Bahauddin Naqschband al-Buchari aus Usbekistan. Dieser Orden hatte großen Einfluss in Zentralasien und verzweigte sich in Syrien in mehrere Unterorden. Besonders hervorzuheben ist die Naqschbandiyya Khaznawiyya, die mehrere religiöse Schulen betreibt, darunter das Irfan-Institut für Islam- und Arabischwissenschaften in Hasaka. Dieses Institut hat Niederlassungen in Syrien und der Türkei. Der Khaznawi-Orden ist besonders aktiv in Deir ez-Zor sowie in ländlichen Gebieten von Aleppo, Idlib und Hama.
Dieser Orden wurde Ende Februar 2014 von ISIS angegriffen, als Kämpfer die Stadt Tal Maruf stürmten und deren Moschee angriffen – unter dem Vorwand, dass sie einem Sufi-Orden zugehörig sei.
Ein weiterer bekannter Sufi-Orden ist die Rifa‘iyya, zurückgeführt auf Ahmad ibn Ali al-Husaini al-Rifa‘i (gest. 578 AH / 1182 n. Chr.), der als eine der bedeutendsten Sufi-Gestalten des 6. islamischen Jahrhunderts gilt. Er wurde als einer der vier großen spirituellen Pole des Sufismus angesehen. Die Rifa‘iyya hat viele Zweige in Aleppo und Nord-Syrien, jeder angeführt von einem Scheich mit seinen Schülern. Auch Anhänger der Rifa‘i wurden von ISIS ins Visier genommen, die im September 2014 mehrere Schreine von Rifa‘i-Sufi-Scheichs in Deir ez-Zor sprengten.
Ein weiterer bekannter Sufi-Weg ist der Orden der Sa‘diyya, der besonders in der Stadt Homs vertreten ist. Die Sa‘diyya al-Jabbawiyya Zawiya, gelegen im Stadtteil Bustan al-Diwan von Homs, ist eines der ältesten religiösen Gebäude, das mit diesem Orden in Verbindung steht.
Moderne religiöse Strömungen
Die salafistischen Strömungen, zu denen einige der derzeit in Teilen Syriens herrschenden Gruppen gehören, sind relativ neue Phänomene in der religiösen Landschaft Syriens. Der Salafismus tauchte erstmals gegen Ende des 19. Jahrhunderts in Syrien auf, insbesondere in zwei der wichtigsten historischen Zentren des Landes: Damaskus und Aleppo. Anfangs ähnelte diese Bewegung dem „reformistischen Salafismus“, der sich unter Scheich Muhammad Abduh in Ägypten entwickelte. Zu ihren frühen Verfechtern in Syrien zählten sowohl intellektuelle als auch religiöse Persönlichkeiten wie Abdul Rahman al-Kawakibi, Jamal al-Din al-Qasimi und Muhammad Rashid Rida.
Aus diesem reformistischen Salafismus gingen mehrere einflussreiche Gesellschaften hervor, die eine Rolle im kulturellen, gesellschaftlichen und politischen Leben Syriens spielten. Zu den bekanntesten zählen die Al-Jam’iyya al-Gharra („Die Glorreiche Gesellschaft“), gegründet von Abdul Ghani al-Daqar, und die Gesellschaft für Islamische Zivilisation, gegründet 1930 von Ahmad Mazhar al-Azma und Bahjat al-Bitar.
Der Salafismus konnte sich jedoch in der konservativen syrischen Gesellschaft, die eng mit traditionellen Religionsgelehrten verbunden war, nie tief verankern. Sein Einfluss beschränkte sich weitgehend auf einen Teil der gebildeten Schicht mit moderner Ausbildung und auf die städtische Mittelschicht. Später kehrte der Salafismus in einer neuen Form zurück, dem sogenannten „wissenschaftlichen“ oder „theoretischen“ Salafismus, vertreten durch zwei prominente Hadith-Gelehrte: Scheich Nasir al-Din al-Albani (1914–1999), ein Schüler von Muhammad Bahjat al-Bitar und beeinflusst von Rashid Ridas salafitisch-hadithorientierten Schriften; sowie Scheich Abdul Qadir Arnaout, der stark von den Werken Ibn al-Qayyims (Schüler von Ibn Taymiyya) geprägt war. Dieser theoretische Salafismus konzentrierte sich auf die Korrektur der Glaubenslehre (ʿaqīda) und die Bekämpfung religiöser Neuerungen (bidʿa), ohne ein politisches Projekt zu verfolgen.
Zur gleichen Zeit verbreitete sich der Salafismus auch durch syrische Arbeitsmigranten in den Golfstaaten, insbesondere in Saudi-Arabien. Viele übernahmen salafistisches Gedankengut durch ihren Kontakt mit der dortigen konservativen wahhabitischen Gesellschaft.
Während des Konflikts des Regimes mit der Muslimbruderschaft nutzte die Regierung diesen Vorwand, um alle unabhängigen islamischen Bewegungen, einschließlich der Salafisten, zu unterdrücken. Scheich al-Albani wurde nach Jordanien ausgewiesen, führende salafistische Persönlichkeiten wie Abdul Qadir Arnaout wurden inhaftiert, und alle daʿwa-Aktivitäten außerhalb staatlicher Kontrolle wurden eingestellt.
Mit Beginn des syrischen Aufstands verbreitete sich der salafistische Gedanke jedoch rasch in ländlichen Gebieten – unterstützt durch ausländische Finanzmittel. Bewaffnete salafistische Brigaden schlossen sich dem Kampf gegen das Regime an, womit sich der Salafismus von einer rein auf Mission ausgerichteten Bewegung zu einer mächtigen militärischen Kraft wandelte.
Heute lässt sich der Salafismus in Syrien im Wesentlichen in drei Hauptströmungen unterteilen:
Wissenschaftlich-traditioneller Salafismus: Konzentriert sich auf religiöse Bildung und daʿwa, meidet Politik und Dschihad. Diese Richtung folgt dem Ansatz von Muhammad Nasir al-Din al-Albani. Aktivistischer Salafismus: Betreibt politischen Aktivismus oder strebt politische Reformen an, etwa in der sogenannten Sururi-Bewegung. Jihadistischer Salafismus: Setzt auf Gewalt und bewaffneten Dschihad als Mittel des politischen Wandels, erklärt bestehende Regime zu Ungläubigen (Takfir), und umfasst Gruppen wie al-Qaida und den sogenannten Islamischen Staat (ISIS).
Zu dieser dritten Strömung zählt auch Hay’at Tahrir al-Sham (HTS), ehemals Jabhat al-Nusra, einst unter der Führung von Ahmad al-Sharʿa (Abu Muhammad al-Julani), den die Gruppe als Übergangspräsidenten Syriens betrachtete. HTS entstand 2017 aus dem Zusammenschluss mehrerer dschihadistischer Fraktionen, darunter Jabhat Fath al-Sham (ehemals al-Nusra-Front), der damalige offizielle Ableger von al-Qaida in Syrien. Weitere Gruppen wie Bewegung Nur al-Din al-Zinki, Jaysh al-Sunna und Liwa al-Haqq schlossen sich an.
HTS verfolgt gewaltsame Ziele, verzichtet aber auf Angriffe gegen westliche Ziele – anders als al-Qaida oder ISIS. Diese Abweichung führte zu Konflikten mit traditionellen Dschihad-Gruppen. 2016 kappte HTS die Verbindungen zu al-Qaida und benannte sich von Jabhat al-Nusra zu Jabhat Fath al-Sham und später 2017 zu Hay’at Tahrir al-Sham um. Diese Abspaltung verärgerte Persönlichkeiten wie Ayman al-Zawahiri, der sie als Verrat an al-Qaidas Kurs betrachtete.
In den letzten Jahren versuchte HTS, sich eher als lokale Autorität denn als globale Dschihad-Gruppe zu präsentieren, obwohl sie weiterhin dschihadistisch-salafistische Ideologie vertritt und versucht, sich an die sich wandelnde politische Realität Syriens anzupassen – im Gegensatz zum globalen Dschihadismus.
Welche Auswirkungen hat der Salafismus heute vor Ort?
Obwohl salafistisches Gedankengut bereits vor der Revolution in Syrien existierte, war sein explosionsartiges Wachstum nach 2011 nicht natürlich, sondern Ergebnis politischer, regionaler und internationaler Faktoren. Ausländische Akteure suchten nach lokalen Kräften, die das Assad-Regime bekämpfen und ihre Interessen vertreten konnten. Gleichzeitig profitierte das Regime davon, die Revolution als islamistisch und extremistisch darzustellen, um russische Unterstützung und westliche Toleranz zu rechtfertigen.
Der salafistische Strom – insbesondere sein jihadistischer Flügel – bot sich aufgrund seiner kampfbereiten Kämpfer und großzügiger externer Finanzierung als geeignetes Mittel an. Mäßigere Fraktionen fehlten es an ideologischer und organisatorischer Stärke gegenüber den radikaleren salafistischen Gruppen.
Die konfessionelle Spaltung zwischen Sunniten und Schiiten im Nahen Osten verstärkte zusätzlich die sektiererische Polarisierung in Syrien, was das Erstarken extremistischer Gruppen begünstigte. Da Syrien zum Schauplatz von Stellvertreterkriegen wurde, erhielten salafistische Gruppen umfangreiche finanzielle und militärische Unterstützung von regionalen Akteuren.
Mit dem Wandel geopolitischer Prioritäten und dem sinkenden Interesse an bewaffnetem Dschihad vonseiten ausländischer Geldgeber, ging diese Unterstützung jedoch stark zurück, was zu einem erheblichen Rückgang der salafistischen Gruppierungen führte.
Auch interne Spaltungen innerhalb der salafistischen Bewegungen in Syrien schwächten deren Einfluss weiter. Ein prominentes Beispiel ist der Konflikt zwischen HTS und Hurras al-Din (ein neuerer al-Qaida-Ableger) über Julianis Abspaltung von al-Qaida. HTS führte zudem militärische Auseinandersetzungen mit ISIS, die auf ideologischen und taktischen Differenzen beruhten.
Trotz einiger militärischer Erfolge fehlte den salafistischen Fraktionen eine tiefe gesellschaftliche Verankerung. In den von ihnen kontrollierten Regionen – wie Idlib, Ost-Ghouta oder Teilen Aleppos – fehlte die breite öffentliche Unterstützung für eine Umsetzung der Scharia im strengen salafistischen Sinne. Als sie versuchten, Maßnahmen wie Zwangsverschleierung, Geschlechtertrennung oder hadd-Strafen einzuführen, stießen sie auf gesellschaftlichen Widerstand.
Die meisten jihadistisch-salafistischen Gruppen waren auf externe Finanzierung angewiesen, nicht auf lokalen Rückhalt. Als diese Gelder versiegten, brachen viele zusammen – ein Beweis dafür, dass sie keine tief verwurzelten sozialen Bewegungen waren.
Jihadistischer Salafismus unterscheidet sich auch in seiner Rechtsauffassung stark von den traditionellen sunnitischen Rechtsschulen wie der hanafitischen oder schafiitischen. Er interpretiert die religiösen Texte oft wörtlich und betont den Dschihad als zentrales Mittel zur Veränderung – im Gegensatz zu den flexibleren Methoden der vier klassischen sunnitischen Rechtsschulen, die sich auf Analogieschlüsse (qiyās) und Konsens (ijmāʿ) stützen.
Jihadsalafisten vertreten zudem strikte Positionen zu zahlreichen Themen, bei denen andere sunnitische Rechtsschulen tolerant sind, was zu Spannungen zwischen traditionellen religiösen Praktiken in Syrien und den rigiden, literalistischen Auslegungen des salafistischen Dschihadismus führt.
Heute sieht sich der salafistische Dschihadismus in Syrien mit einer neuen Realität konfrontiert. Der Salafismus hat in seinen früheren Hochburgen – insbesondere in Saudi-Arabien und den Golfstaaten – deutlich an Einfluss verloren, was auf veränderte regionale Dynamiken zurückzuführen ist. In Saudi-Arabien zielt die Umsetzung der Vision 2030 darauf ab, die Gesellschaft zu modernisieren und die Abhängigkeit von der traditionellen salafistischen Doktrin zu verringern. Diese Politik hat salafistische Religionsinstitutionen geschwächt und einen moderateren religiösen Diskurs gefördert. Zudem hat das Königreich seine Unterstützung salafistischer Bewegungen im Ausland deutlich eingeschränkt.
Hay’at Tahrir al-Sham (HTS) erhält heute in erster Linie Unterstützung von der Türkei und Katar. Die Türkei verfolgt mit ihrer Unterstützung mehrere strategische Ziele, das wichtigste davon ist die Eindämmung der kurdischen Bedrohung. Konkret unterstützt die Türkei islamistische Fraktionen, um den Einfluss der YPG (Volksverteidigungseinheiten) entlang ihrer Südgrenze zu begrenzen.
Katar wiederum unterstützt HTS im Rahmen seiner umfassenderen regionalen Strategie, den eigenen Einfluss durch die Förderung politisch-islamischer Bewegungen – darunter auch die Muslimbruderschaft – zu erweitern. Diese Unterstützung dient Katars politischen Interessen und stärkt seine Rolle in der Region.
Allerdings stößt diese Unterstützung an klare Grenzen. So kämpft die Türkei mit einer anhaltenden Wirtschaftskrise. Gleichzeitig haben westliche und regionale Akteure klare Bedingungen für ein zukünftiges syrisches Regime formuliert: Es muss ernsthafte politische Reformen auf nationaler Ebene einleiten, insbesondere eine Beteiligung verschiedener gesellschaftlicher Gruppen am politischen Leben sicherstellen. Diese Voraussetzungen gelten als wesentlich für eine Unterstützung beim Wiederaufbau und für die Aufhebung der seit dem alten Regime verhängten Sanktionen.
Schlussfolgerungen:
– Die Geschichte Syriens zeigt, dass der Salafismus als religiöse Bewegung nie eine weitreichende Wirkung oder breite gesellschaftliche Akzeptanz innerhalb der syrischen Bevölkerung genossen hat. Die religiöse Landschaft Syriens wurde historisch von den traditionellen islamischen Rechtsschulen – insbesondere der hanafitischen und schafiitischen – dominiert, ebenso von starken Strömungen des Sufismus und des Aschʿaritentums. Diese traditionelle Ausrichtung spielte eine zentrale Rolle bei der Eindämmung der Ausbreitung salafistischer Ideologie, die auf bestimmte daʿwa-Kreise beschränkt blieb.
– Mit dem Ausbruch der syrischen Revolution im Jahr 2011 entstanden einige bewaffnete salafistische Gruppierungen, die das politische und sicherheitspolitische Vakuum ausnutzten. Diese Fraktionen konnten jedoch keine breite Akzeptanz unter den vielfältigen gesellschaftlichen Gruppen Syriens gewinnen. Im Gegenteil: Ihre rigiden Auslegungen und Praktiken stießen bei vielen Syrern mit unterschiedlichem religiösem und kulturellem Hintergrund auf Ablehnung und Widerstand.
– Es lässt sich sagen, dass die syrische Gesellschaft – mit ihrer religiösen und kulturellen Vielfalt – grundsätzlich nicht geneigt ist, ein Regierungssystem nach salafistischem Vorbild zu akzeptieren. Sowohl die historischen als auch die aktuellen Erfahrungen zeigen, dass es dem Salafismus nicht gelungen ist, eine breite gesellschaftliche Basis zu etablieren, und dass Versuche, einen salafistischen Ansatz in Syrien durchzusetzen, wahrscheinlich auf erheblichen Widerstand und Ablehnung in der Bevölkerung stoßen werden.
– Wenn keine ernsthaften Schritte zur politischen Teilhabe aller syrischen Bevölkerungsgruppen unternommen werden, wird dies in eine Form der Minderheitenherrschaft über die Mehrheit münden. In einem solchen Szenario werden HTS und andere dschihadistisch-islamistische Gruppen sich wahrscheinlich noch stärker abschotten und auf Gewalt sowie externe Unterstützung angewiesen sein, um ihre Macht aufrechtzuerhalten.